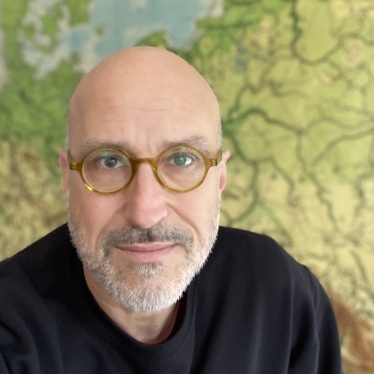Sollte man sein Wahlrecht verlieren, wenn man vorbestraft ist?
In den USA ist in den letzten Wochen eine öffentliche Debatte über dieses Thema entbrannt, aus naheliegenden Gründen. Doch trotz der Tendenz der Medien, sich auf einzelne Persönlichkeiten zu konzentrieren, hat die ganze Aufregung auch ein grundlegendes Problem ans Licht gebracht.
Die USA sind im Vergleich zum Rest der Welt rückständig, was die Verweigerung des Wahlrechts für eine große Anzahl von Menschen aufgrund von strafrechtlichen Verurteilungen betrifft – ein Phänomen, das als „felony disenfranchisement“ (dt. etwa: Entzug des Wahlrechts aufgrund von Straftaten) bekannt ist.
Ein neuer Bericht untersucht Gesetze in 136 Ländern auf der ganzen Welt und stellt fest, dass die meisten Länder Verurteilungen nie oder nur selten dazu nutzen, einer Person das Wahlrecht zu entziehen. Und selbst unter den Ländern, die dies tun, sind die USA eines der strengsten, da sie einem größeren Teil der Bevölkerung das Wahlrecht entziehen.
In den USA sind derzeit mehr als 4,4 Millionen Bürger*innen aufgrund von strafrechtlichen Verurteilungen vom Wahlrecht ausgeschlossen. Das entspricht der gesamten Bevölkerung der US-Bundesstaaten Kentucky oder Oregon.
Und natürlich sind einige Bevölkerungsgruppen stärker betroffen als andere. Ethnische Minderheiten, insbesondere Schwarze Amerikaner*innen, werden „weiterhin unverhältnismäßig häufig verhaftet, inhaftiert und härteren Strafen unterworfen, einschließlich lebenslanger Haft ohne Bewährung ...“ Daher ist es ihnen auch unverhältnismäßig oft untersagt, zu wählen.
Einer von 19 wahlberechtigten Schwarzen US-Amerikaner*innen hat kein Wahlrecht aufgrund dieser Gesetzgebung. Das sind dreieinhalbmal so viele wie bei nicht-schwarzen US-Amerikaner*innen.
Und wieder einmal sehen wir, wie das allgegenwärtige Gift der weißen Vorherrschaft in der US-Geschichte die Ursache für das Versagen der USA in Bezug auf Grundrechte ist.
Die US-Gesetze, die die Aberkennung des Wahlrechts bei Straftaten vorschreiben, stammen aus der Zeit unmittelbar nach dem Ende des amerikanischen Bürgerkriegs. Nachdem die vormals versklavten Schwarzen Männer durch den 14. Zusatzartikel der US-Verfassung das Wahlrecht erhalten hatten, begannen die Gesetzgeber der Bundesstaaten, die Liste der als Straftaten definierten Vergehen zu erweitern, um Schwarze ins Visier zu nehmen. Gleichzeitig begannen die Bundesstaaten, das Wahlrecht bei jeder Verurteilung wegen einer Straftat zu entziehen.
Einige dieser als „Jim-Crow-Gesetze“ bekannten Maßnahmen wurden von der US-Regierung im Voting Rights Act von 1965 offiziell verboten, aber in 48 US-Bundesstaaten gelten nach wie vor Gesetze, die bei Verurteilung wegen eines Verbrechens das Wahlrecht entziehen.
Die aktuelle Medienberichterstattung mag sich zwar auf einen einzelnen Mann konzentrieren, aber es geht hier nicht um eine Einzelperson. Es geht um 4,4 Millionen Menschen, die an der Ausübung eines Grundrechts gehindert werden.
Damit stehen die USA weitestgehend im weltweiten Abseits – seltsam für ein Land, das sich selbst gerne als Vorreiter der Demokratie sieht.